
| 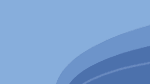  |  |
„Das erste Mal“ Berlin 2006 „Was ist mit Berlin?“ Diese scheinbar wie nebenbei in den Raum geworfenen Frage unseres Lauftrainers Josef Drolc am Ende einer Trainingseinheit löste bei mir nur wenig Emotionen aus. Ich quälte mich als Laufanfängerin gerade anständig mit dem Training für den Hermannslauf herum und hatte noch keinen Gedanken an die Zeit danach verschwendet. Alle anderen, die den Berlin Marathon bereits ein- oder zweimal gelaufen waren, reagierten aber prompt. Von „oh ja, das war toll“ bis „oh je, wieder diese Quälerei“ reichten die Ausrufe. Aber bald war klar: Alle Marathon-Läufer des vergangenen Jahres wollten wieder an den Start, dazu drei Frauen, die die Strecke mit Inline-Skates fahren wollten. Jetzt war ich mit einer Entscheidung dran. „Wenn es mit dir so weiter geht wie jetzt, könnte es klappen“, war die Trainer-Einschätzung. Also nickte ich – nichts ahnend, was eigentlich hinter dem Wort „Marathon“ stehen wird. Doch zunächst kam der Frühsommer, die Zeit des Mountain-Bikens und des Rennrad fahrens, die Zeit der Waldtouren und der RTF`s. Gelegentlich liefen wir auch mal, damit die Beine sich noch annährend daran erinnerten. Ab Mitte Juli aber war der Spaß vorbei und das Marathon-Training begann. Zu Anfang war ich noch sehr enthusiastisch und engagiert. Da gab es das große Ziel im September, das zum Glück aber noch so weit weg war und es gab die schillernden Schilderungen der Laufkollegen, die die Stimmung und die Atmoshpäre in Berlin bereits erlebt hatten. „Mach dir keine Sorgen“, hieß es da immer wieder, „du wirst quasi ins Ziel getragen“. Fröhlich lief ich also täglich mit den anderen meine vom Trainer angeordneten Kurzstrecken zwischen 10 und 15 Kilometern. Bis dann die ersten langen Läufe kamen. 20, 25, 30 Kilometer. Nie zuvor war ich so weit und so lange gelaufen. Nie zuvor haben Muskeln, Sehnen und Gelenke zunächst so protestiert wie nach den ersten Langläufen. Ich werde also ins Ziel getragen? Na hoffentlich ist das wörtlich zu nehmen, denn 42 Kilometer zu laufen erschien mir utopisch. Die letzten Trainingswochen fielen dann auch noch in meinen Urlaub in Griechenland. Die Hitze ließ das Training nur am frühen Morgen zu. Zum Glück waren zwei Laufkollegen einen Teil des Urlaubs mit dabei, sonst hätte ich die Einheiten nicht durchgehalten. So kamen wir in den Genuss, jede Straße, jeden Pfad und jeden Eselspatt auf der Insel Paxos laufend kennenzulernen. Den Olivenbauern dort war zwar ein deutliches Erstaunen und Kopfschütteln anzumerken, wenn sie uns drei verrückten Touris morgens um 7 Uhr durch die Plantagen laufen sahen, aber die Menschen dort blieben freundlich und grüßten höflich. Was sie wirklich gedacht haben – ich möchte es gar nicht wissen… Nach dem „Trainingslager Urlaub“ wird es ernst. Am Freitag, 22. September steigen wir in den Zug. In der 1. Klasse (was anderes gab es nicht mehr…) geht es nach Berlin. Die Stadt haut mich um. Menschenmassen, die sich durch den Bahnhof und durch die U-Bahn wälzen. Drangvolle Enge und schlechte Luft in den Unterführungen. Unglaublich riesige Plätze, weite Flächen und breite, belebte Straßen überirdisch. Gut, das die meisten aus der Gruppe „Schinderjupp`s Lactatexpress“ schon mal hier waren und sich auskennen. Am Abend beim gemeinsam Essen werden Pläne für den Samstag gemacht: Sight-Seeing und die Inline-Skater begleiten heißt das Programm. Als ich am nächsten Tag bei der Begleitung der drei Inline-Skater das ganze Ausmaß dieser Veranstaltung begreife, wird mir mulimig. Ein Riesen-Event. 39.000 Starter bei den Läufern. Was ist, wenn ich es nicht schaffen? Was würden die anderen sagen, die mich wochenlang durch das Training begleitet und mir immer wieder Mut zugesprochen haben? Bin ich wirklich fit genug, habe ich genug Erfahrung mit mir selbst und meinem Körper, um 42 Kilometer lang die richtige Entscheidung über Tempo, Puls, Essen und Trinken zu treffen? Doch heute sind erstmal die Skater dran. Und schon bei dieser Veranstaltung ist die Stimmung riesig. Erika, Gaby und Heike geht es so auch blendend, als sie bei Kilometer 20 winkend an uns vorbeirauschen, alle drei kommen glücklich und ohne Sturz im Ziel an. Der Sonntag ist da. Früh morgens um 6.45 Uhr machen die Läufer sich auf den Weg zum Start. Die Wettervorhersage kündigt einen für September ungewöhnlich warmen Tag an. Unterwegs in der U-Bahn überschlagen sich meine Gedanken: Hab ich genug gegessen oder vielleicht schon zuviel? Habe ich alles nötige im Getränkegurt? Passt die Menge des kohlenhydrathaltigen Getränkes? Denn wenn die Konzentration zu hoch ist, rebelliert mein Magen, und so ein Durchfall unterm Brandenburger Tor oder vor dem Bundestag – besser nicht weiter denken. Ich horche in mich hinein: Tut mir da nicht jetzt schon die Kniesehne weh, die immer weh tut? Und die Stelle am rechten Fuß? „Ich hab jetzt schon so schwere Beine“, stöhnt Laufkollege Andreas, der heute ebenfalls zum ersten Mal an den Marathon-Start geht und ich nicke wortlos. Doch dann gibt es kein zurück mehr. Schon der Start ist ein Erlebnis. Hubschrauber mit Fernsehkamerateams kreisen über uns, die Sonne strahlt, tausende von Luftballons werden beim Start von den Läufern in den Himmel entlassen. Beim Herunterzählen des Countdowns für unseren Block bekomme ich eine Gänsehaut. Und dann setzt sich die Masse von Block H in Bewegung. Andreas und ich, wir beiden Newcomer, nehmen uns vor, möglichst zusammen zu bleiben – für den ersten Marathon genau die richtige Entscheidung, wie wir hinter feststellen. Denn immer wieder tauschen wir uns unterwegs kurz aus über Pulswerte, beginnende Schmerzen oder einfach nur darüber, wie man sich fühlt. Die ersten 20 Kilometer vergehen wie im Flug. Menschen jubeln, pfeifen und applaudieren entlang der Strecke. Wir laufen von einer Klangwolke in die nächste, denn fast an jeder Ecke steht eine Musikband. Samba, Salsa, Steel drums oder Blasorchester – da ist für jeden Geschmack etwas dabei. Anwohner haben Musixboxen auf die Balkone geschoben und beschallen die Massen straßenzügeweise mit Techno oder Klassikmusik. Dazu steht am Straßenrand die gehobenere Berliner Gesellschaft oder ein paar zahnlose Obdachlose, die mit einer Bierflasche in der Hand ein Tänzchen wagen. Wir winken, klatschen Hände ab, die sich uns entgegenstrecken und feiern diese Riesenparty entlang der Strecke mit. Die Feuerwehr hat riesige Wasserspritzen aufgestellt, die wie Duschen wirken und erhitze Läufer abkühlen. Immerhin ist das Thermometer im Laufe des Vormittages auf 28 Grad gestiegen. Wir sind etwa bei Kilometer 22, als neben uns ein Radfahrer mit einen Radio auf dem Gepäckträger fährt. Im Radio gibt es eine Live-Reportage vom Marathon, und in dem Moment läuft der Sieger nach 2 Stunden und 5 Minuten bereits durchs Ziel. Auf der Strecke gibt es spontanen Applaus von Läufern und Zuschauern für den schnelle Äthiopier. Nach 25 Kilometern aber rücken die Beine wieder mehr in den Mittelpunkt des Denkens. Bis 30 Kilometer, das wissen wir beide, halten wir durch – das sind wir ja im Training schon gelaufen. 31, 32 und ab 33 beginnt für mich die Quälerei. Die Leute an der Straße interessieren mich nicht mehr, Engelchen und Teufelchen kämpfen in mir um die Oberhand. „Bleib stehen bleib einfach stehen. Du musst das hier nicht machen, wofür denn auch“, sagt das Teufelchen. „Lauf weiter, gib jetzt nicht auf“, sagt das Engelchen. An der Straße halten die Zuschauer Plakate hoch: „Umkehren wäre jetzt auch blöd“, steht auf dem einen, „Durchhalten! Ihr schafft es! Ihr seit großartig!“ auf den anderen. Mein Mitläufer Andreas kämpft ebenfalls. Wir versuchen, das Tempo zu reduzieren und etwas Erholung herauszuschlagen. Aber schon nach kurzer Zeit sind wir wieder im schnellen Tritt. Und während wir uns noch gegenseitig motivieren und einer den anderen irgendwie mitzieht, erscheint am Straßenrand die Kilometeranzeige „39“. Da packt mich die Wut: „Jetzt bist du verdammte 39 Kilometer gelaufen, jetzt hältst du die besch… letzten drei auch noch durch“, rede ich mir energisch ein. Die Beine sind platt, als ich endlich das Brandenburger Tor sehe. Andreas hat mir der Hitze zu kämpfen und läuft am Limit. Bei mir lässt einfach die Kraft nach – so laufen wir wieder beide gleich schnell. Der Jubel und Zuspruch der Zuschauer beim Endspurt „Unter den Linden“ ist sagenhaft. „Die tragen mich regelrecht ins Ziel“, denke ich und erinnere mich daran, diesen Satz schon mal gehört zu haben. Wir laufen durchs Brandenburger Tor. In dem Trubel entdecke ich auf der linken Seite tatsächlich die anderen aus der Gruppe, die uns am Ziel erwartet haben. Auch sie jubeln und rufen. Noch knapp 400 Meter – und wir haben es geschafft, in einer Zeit von 4 Stunden. 24. Erleichtert fallen wir uns in die Arme. Wir strahlen um die Wette. Es geht uns sehr sehr gut, von der körperlichen Erschöpfung und den schmerzenden Beinen mal abgesehen. Es hat alles gepasst: Das Training und die Vorbereitung, die Ernährung, das Trinken und vor allem die Selbsteinschätzung. Ich bin unendlich stolz und glücklich. Auf das Massenduschen in den Zelten verzichten wir und treffen auf dem menschenüberfluteten Gelände die anderen Läufer und Begleiter von Schinderjupp`s Lactatexpress. Die Stimmung ist fröhlich und ausgelassen, wir beglückwünschen uns und machen Fotos. Ich fühle mich total frei im Kopf, körperlich schwach, aber innerlich stark und kräftig. Was kann mir jetzt noch passieren? Ich bin schließlich gerade einen Marathon gelaufen! Dann müssen wir uns schon wieder auf den Rückweg machen. Und das heißt, zurück zum Hotel, duschen und Gepäck holen, wieder zum Bahnhof und ab in den Zug. Die Treppen zu den U-Bahnen runter und wieder rauf machen wir jetzt schon Schwierigkeiten. Die Beine wollen nicht mehr, sind kraftlos und schmerzen. Aber egal. Am Bahnhof gibt es noch Ärger: Der Wagen mit unserem Abteil und den fest reservierten Plätzen wurde vom Zug abgekoppelt und ist einfach nicht mehr da. Nach langem Hin und Her und energischen Worten unsererseits werden andere 1.-Klasse-Reisende von ihren Plätzen hochgescheucht und müssen im Gang stehen, wir bekommen deren Abteil. Aber heute habe ich wenig Mitleid. Wir haben fest gebucht und ich muss sitzen. Als ich nach ca. anderthalb Stunden Zugfahrt mal aufstehen will, sticht mir jemand mit einem heißen Messer in die Oberschenkel. Jedenfalls habe ich so ein Gefühl. Dann hat der Zug auch noch Verspätung, und wir müssen im Laufschritt umsteigen – jeder Schritt wird zur Tortour. Zuhause angekommen, finde ich noch lange keine Ruhe. Die Nacht ist kurz, der nächste Tag wieder ein normaler Arbeitstag. Am nächsten Morgen wache ich auf und kann nicht recht glauben, dass das, was da an meinem Körper hängt, meine Beine sein sollen. Der Muskelkater ist sehr heftig, jetzt tun die Kniesehnen wirklich weh. Ich schleppe mich ins Bad. „Das tue ich nie wieder“, denke ich und schaue in den Spiegel.
„Oder vielleicht doch?“… Daggi
|  |
|
 |  |  |
Vätternrundan 2007 in Schweden 310km in 10:08h
|  |
Vätterrundan 2007 Wer oder was hat mich eigentlich geritten, an dieser Geschichte hier teilzunehmen? Ich stehe morgens um 5 Uhr bei strahlendem Sonnenschein aber höchstens 8 Grad in einem winzigen Ort namens Motala in Schweden vor einem rot-weißen Absperrband. In voller Radfahrer-Montur, bepackt mit Camel-Back, Regenjacke und Überschuhen an den Füßen. Ich weiß, gleich kommt der Countdown, und dann muss ich da durch. 300 Kilometer am Stück. rund um den Vätternsee. Mit mir warten etwa noch 70 andere Verrückte auf den Start. Über 17.000 sind schon unterwegs. Nervosität macht sich breit. Da kommt einer nicht rechtzeitig aus den Klickern und fällt schon vor dem Start um. Na super. Mit mir sind auch Peter, Heike, Yvonne, Andreas und Josef. Wir sechs wollen es packen. Aber, wie gesagt, wer hatte eigentlich die Idee? Rückblende: Es war der 19. Juli 2006, ein enorm heißer Sommertag und mein Geburtstag. Bei 38 Grad im Schatten hatte ich Kürbiscremesuppe angeboten und stehe jetzt mit einigen Litern Restsuppe da. Egal. Irgendwer erzählt von diesem Rad-Event in Schweden, rund um so einen See. Ich schleppe unseren uralten Atlas ran, der Vätternsee ist schnell gefunden. „Wie willste denn da hinkommen“ – „Ich fahre nicht nachts“ – „Viel zu teuer“ – „Puh ist das warm heute“, lauten die Kommentare. Alles ganz normal: unsere Tourplanungen beginnen meistens so. Der Plan aber lässt unseren Trainer Josef nicht los. Plötzlich bekommen wir von ihm per E-Mail Infos über die Veranstaltung, Kosten, usw. Im Winter sprechen wir noch mal über das Thema, denn die Zeit drängt, der Anmeldeschluss läuft allmählich ab. Die Idee, mit dem Wohnmobil nach Schweden zu fahren und dort drei Tage auf dem Campingplatz zu residieren, wird zunächst von einigen Teilnehmern entrüstet abgelehnt. „Viel zu eng“ – „Nicht billiger als ein Hotel“ – „Ich will mein eigenes Klo“ – „Und wie sollen die Räder mit?“ Wie gesagt: die meisten unserer Touren beginnen so… Nach zahlreichen Diskussionen steht der Plan dann endlich fest und am 13. Juni geht`s los. Wir packen das Wohnmobil randvoll bis unters Dach (geht doch…), fahren bis Kiel und dort auf die Fähre nach Göteborg. Überfahrt bei bestem Wetter, wir aalen uns auf den Liegen auf dem Sonnendeck und genießen anschließend ein herrliches Abendbuffett mit reichlich leckeren Fischgerichten. Die Ankunft in Schweden ist erstmal desillusionierend, was das Wetter angeht: Bedeckter Himmel, windig, kalt. Die Wettervorhersagen im Internet haben leider auch für den Tag der Veranstaltung Regen angesagt. Aber noch sind wir bei guter Laune, staunen über die Landschaft und die Häuser, die tatsächlich aussehen wie aus der Kinderserie „Ferien auf Saltkrokan“. Dann der Ruf unseres Fahrers Peter: „Seht mal alle links aus dem Fenster, das ist der Vätternsee“. Wir schieben die Gardinen zur Seite – und keiner sagt ein Wort. Ehrfurchtsvolles Schweigen. Unterschwelliges Entsetzen. Ungläubigkeit. „Das ist kein See, das ist doch ein Meer“, drücke ich schließlich aus, was alle denken. Der Vätternsee ist riesig. Das andere Ufer ist nicht zu sehen. Wasser, soweit das Auge reicht. Da wollen wir drumherum fahren? Na Prost Mahlzeit… Unsere Gedanken kreisen noch einmal um die letzten Trainingswochen. Bislang haben wir geglaubt, das reicht locker. Wir waren dreimal in der Woche gefahren, haben mehrere Radmarathons mit über 200 Kilometern abgerissen und hatten das Gefühl, unsere Hintern haben allmählich die Form der Fahrradsättel angenommen. Jetzt die Zweifel: war das wirklich genug? Bei Winden mit Sturmstärke platzieren wir das Wohnmobil auf dem Campingplatz in Vadstena direkt am Wasser. Während wir in dicken Fleece-Jacken und mit Kappen auf dem Kopf verzweifelt versuchen, zusätzlich eine Zelt aufzubauen, schauen uns schwedische Urlauber amüsiert zu. Sie sitzen mit Träger-Top oder bloßem Oberkörper vor ihren Wohnwagen – bei Windstärke 6 und 18 Grad. Ein paar kleine Kinder gehen gerade im See baden. So sind sie halt, die nordischen Völker! Am Abend holen wir noch die Startunterlagen aus dem 15 Kilometer entfernten Start-Ort Motala ab. Allerdings fahren wir mit dem Taxi – viel zu windig zum Radfahren… Am nächsten Tag hat der Wind nachgelassen. Wir schauen uns per Rad die Gegend an, testen, wie lange wir vom Campingplatz bis zum Start brauchen und essen früh. Ab ca. 20.30 Uhr sausen die ersten Väternrundan-Fahrerfelder an unserem Campingplatz vorbei. In 10minütigem Abstand gehen ab 20 Uhr immer etwa 70 Radler ab Motala auf die Piste. Während die schon fahren, legen wir uns noch ein bisschen schlafen, denn wir sind eine der letzten Startgruppen um 5 Uhr morgens. Um 2.30 Uhr ist die Nacht zuende. Draußen ist es schon fast hell, aber eiskalt. Was zieht man nur an? Nimmt man die Regenjacke mit? Überschuhe oder nicht? Und wie soll ich um diese Uhrzeit mein Frühstück runterkriegen? Um 3.30 Uhr sitzen wir auf den Rädern Richtung Motala. Es ist schon lange hell, schließlich ist Mittsommerzeit. Doch jetzt geht auch die Sonne auf, und wir fahren ihr direkt entgegen. In Sekundenschnelle taucht die Sonne die Landschaft und uns in ein gleißend gelb-rotes Licht. Wir jubeln: Was kann jetzt noch schief gehen? Doch jetzt sind die Zweifel wieder da, morgens um 5 Uhr, hier vor dem rot-weißen Absperrband. Dann ist es soweit: die Tour beginnt. Anfangs rollen wir locker, aber trotzdem mit über 30 kmh mit der Gruppe mit. Das klappt gut, und ich gewöhne mich daran, so viele Radfahrer um mich zu haben. Nach den ersten Anstiegen fällt das Starterfeld auseinander. Genau im richtigen Moment signalisiert uns Trainer Josef, das wir uns jetzt absetzen und unser eigenes Ding fahren. Wochenlang haben wir das geübt, das enge Windschattenfahren, der Vordermann bleibt 15 Minuten vorne im Wind, lässt sich dann zurückfallen und der nächste fährt 15 Minuten im Wind. Dabei sollte die Geschwindigkeit so sein, dass möglichst immer eine „3“ als erste Zahl auf dem Tacho steht. Auch wir drei Frauen erfüllen unsere Viertelstunden in der Frontposition. Für Heike und Yvonne kein Problem, die beiden fahren seit Jahren Fahrrad und haben enorme Kraft in den Beinen. Anfangs auch für mich kein Problem. Anfangs… Die erste Verpflegungsstelle kommt bereits nach 43 Kilometern. Wir lassen sie links liegen, wollen unseren Rhythmus nicht unterbrechen und brausen an vielen anderen Vätternrundan-Fahrern vorbei bis Gränna. Getränke auffüllen, Dixie-Klo aufsuchen und ein erstes Honigbrötchen probieren – schmecken gut, die Dinger. Die Blaubeersuppe reizt, doch wir halten uns alle an unsere Absprache: Blaubeersuppe frühestens im Ziel – wer weiß, wie die auf Magen und Darm wirkt! Vor der ersten richtigen Pause in Janköpping sind ein paar gehörige Anstiege zu fahren. Ich kann das Tempo nur noch mithalten, wenn ich kontinuierlich auf dem großen Blatt fahre. Trainiert habe ich aber auf dem kleinen. Also: bereits nach 90 Kilometern tun mir zum ersten Mal die Knie weh. Ich ignoriere das. Die Verpflegung in Janköpping bei Kilometer 109 erreichen wir nach einer Zeit inklusive der Pause in Gränna nach 3 Stunden und 52 Minuten. Wir strahlen um die Wette. Na, wenn das so weitergeht! Angeboten werden Würstchen mit Kartoffelbrei, und das um 9.30 Uhr. Ich verzichte auf die Würstchen, der Kartoffelbrei füllt, und so ein Honigbrötchen, das nehme ich auch noch. Danach geht es genauso flott weiter. Regelmäßiger Wechsel vorne, die starken Fahrer in unserer Gruppe nehmen sich etwas zurück, die schwächeren geben etwas mehr Gas, das Tempo passt. Außerdem sind wir guter Hoffnung: „Nach Janköpping kommen kaum noch Berge“, behauptet Peter, der – angeblich – das Höhenprofil der Strecke genau studiert hat. „Das schlimmste haben wir hinter uns“. Also laufen auch die nächsten Kilometer wie am Schnürchen. Doch eine gute Stunde später frage wir uns, von welchem Rad-Event Peter das Höhenprofil studiert hat. Dies kann es nicht gewesen sein. Es kommen ziemlich heftige Anstiege, einer nach dem anderen. Auf den letzten Kilometern vor Hjo muss ich wirklich die Zähne aufeinander beißen, verliere häufig den Anschluss an die Gruppe. Von wegen, keine Anstiege mehr! In Hjjo, bei Kilometer 178, gibt es wieder eine warme Mahlzeit: Lasagne, verschiedene Brotsorten und – Honigbrötchen. Dafür lasse ich doch jedes Knäckebrot liegen. Mittlerweile haben wir das Feld von hinten aufgerollt, treffen an dieser Verpflegungsstelle noch auf tausende Radfahrer. Die Atmosphäre auf dem großen Platz ist sehr entspannt, ruhig, freundlich und gelassen. Es sind offensichtlich kaum Chaoten dabei. Nur einen haben wir auf der Strecke erlebt, ein Engländer, den wir überholten und der sofort Fahrt aufnahm, um mit Heike, der Frontfahrerin irgendwie ins Gespräch zu kommen. Er wirkt aufdringlich und chaotisch, reißt mehrere Male sein Rad in die Luft und macht Sprünge mit dem Rennrad, als sei es ein Mountain bike. Wir sind froh, als wir ihn los sind. Doch einige Kilometer später ist er plötzlich wieder da, klebt jetzt an Yvonne, die vorn fährt. Wieder diese blöde Springerei, einmal, zweimal – und dann passiert es. Das Rad kommt schräg auf und unser Radartist saust nach recht in ein Waldstück, überschlägt sich und landet im Schlamm. Ich fahre ganz hinten und bekomme das ganze gar nicht mit. Ich höre nur vorn schallendes Gelächter und sehe ihn plötzlich rechts neben mir aus dem Gebüsch krabbeln. Das ist mir klar, was passiert war. Doch er ist die Ausnahme. Jeder lässt sein Rad hier an der Verpflegungsstelle unbewacht stehen, um sich Getränke oder Essen zu holen – offensichtlich klaut in Schweden niemand Fahrräder. Mittlerweile hat sich die Sonne verzogen, eine Wolkendecke hängt über dem See und es wird sehr kalt. Wir sechs sind eigentlich noch ganz gut drauf, zwei allerdings plagen schlimme Krämpfen in den Beinen. Mit etwas Ruhe und viel Magnesium kriegen wir das wieder in den Griff. Immerhin haben wir jetzt über die Hälfte geschafft. Doch das letzte Drittel fordert all unsere Kraft. Der Wind nimmt zu, die Kälte macht mir zu schaffen. Und flach ist das hier auch nicht. Als ich das Schild „noch 100 Kilometer“ sehe, bin ich erst erleichtert, doch dann wird mir klar: Das sind locker noch 3,5 Stunden. Doch zunächst amüsieren wir uns in Karlsborg über ganz besondere Toiletten für die Herren: Hinter einer Wand aus Plastikfolie stehen mehrere 30-Liter-Eimer. Randvoll mit Urin. „Wer wird die wegtragen müssen?“, fragen wir uns für einen kurzen Moment, kehren dann aber auf die Sättel und damit zu unseren eigenen Problemen zurück. 220 Kilometer sind geschafft. Ab jetzt muss ich nicht nur gegen meine Beine und Knie kämpfen, sondern auch noch gegen den Kopf. Denn länger war ich bisher nie gefahren. Und dann kommt der Wind. Mit aller Macht, direkt von vorn. Wieder Sturmstärke. Unsere Geschwindigkeit sinkt, mein Mut auch. Panik macht sich in mir breit, denn ich habe das Gefühl, ich halte die ganze Gruppe auf. Ich kann das Tempo berghoch nicht mehr halten, immer größer wird bei den Anstiegen die Lücke zwischen mir und den anderen und zu allem Übel kommt jetzt eine Rampe nach der anderen. Je mehr ich mich ärgere und innerlich aufrege, umso weiniger Kraft habe ich und fange an zu jammern: „Ich kann das Tempo nicht mehr halten, mir tut alles weh“ – „Mir tut auch alles weh, und das schon seit geraumer Zeit. Jammer nicht – fahr!“ ist die klare Traineransage. Also nehme ich mich zusammen, halte Anschluss, so gut es geht. Letzte Verpflegung bei Kilometer 282, in Medevi. Wie heißt es in der Streckenbeschreibung: „Im alten Heilbrunnenstädtchen Medevi lädt die Sommerwiese zu einer letzten Rast ein: probieren Sie ein Honigbrötchen“. Wenn ich noch ein son Ding essen muss, krieg ich das Kotzen! Doch dann kommt mir die Straße bekannt vor. Das ist die Strandpromenade von Motala. Ja! Wir sind da! Alle sechs rauschen wir über die Ziellinie. Es gibt Umarmungen, Medaillen, Kaffee und Nudelsalat. Nur keine neuen Knie. Die wären mir jetzt lieber gewesen. Wir können es noch gar nicht fassen. Unsere reine Fahrzeit betrug 10 Stunden und 8 Minuten – fast ein 30er-Schnitt. Für uns ist das sensationell. Nach kurzer Freudenpause aber holt uns die harte Realität wieder ein: Wir müssen ja noch zurück zum Campingplatz nach Vadstena. 15 Kilometer, die ich vor Kälte zitternd mit schlappen, schlotternden Beinen irgendwie auch noch fahre. Nach dem Duschen dann kommt dieses wohlige Gefühl der tiefen inneren Zufriedenheit. Herrlich. Wir sitzen alle im Wohnmobil und essen, was das Zeug hält. Die Gesichter sind rot und rissig, der Wind hat die Haut total ausgetrocknet. Und dann kommt der Regen. Pladdert die ganze Nacht und am nächsten Morgen noch aufs Wohnmobildach. Na und? Vätterrundan macht irgendwie gelassen.
|
|
| 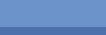

 |  | | | | josef.drolc@osnanet.de
|  |
|